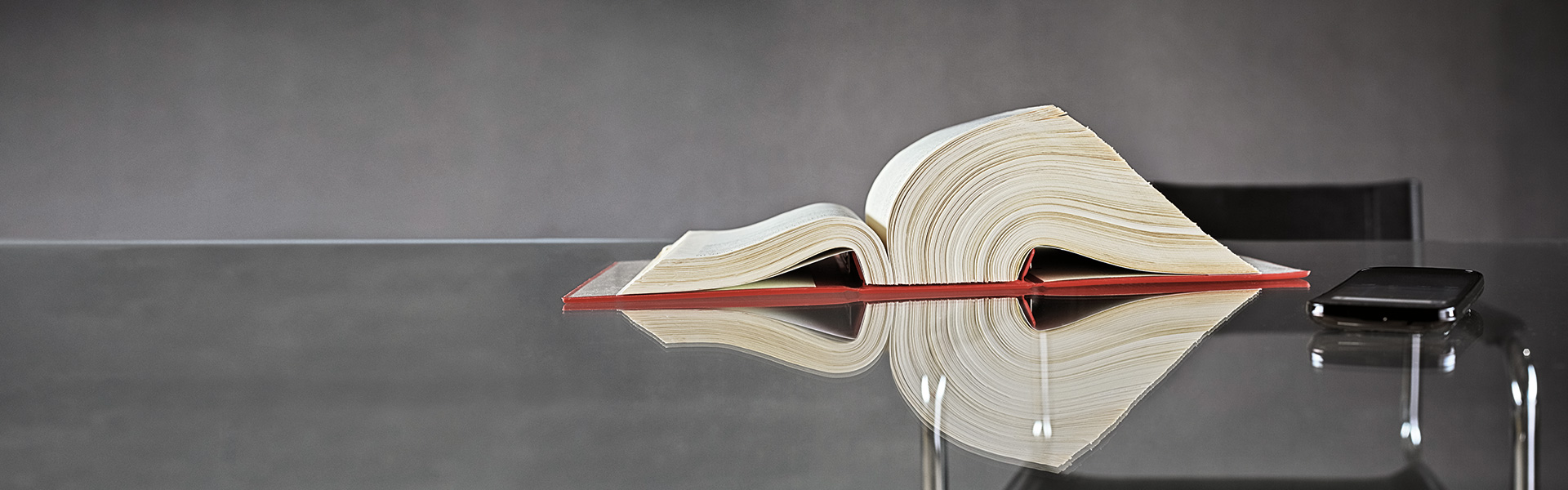
§ 2077 BGB - Die Unwirksamkeit eines Erbvertrages im Falle einer Ehescheidung
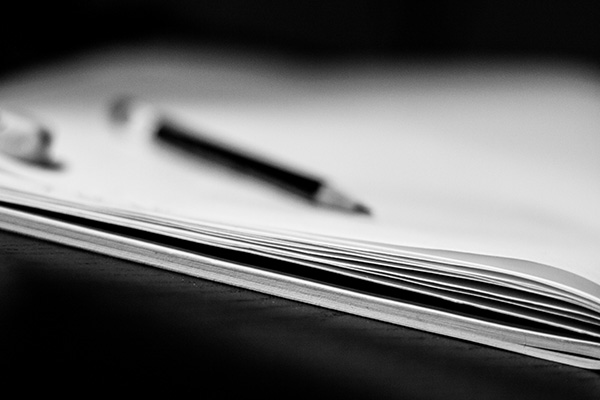
Einleitung:
Ob ein Erbvertrag in bestimmten Fällen nach einer Ehescheidung unwirksam ist, beschäftigte den BGH knapp vor einem Jahr aufgrund eines interessanten Falles. In diesem waren die Vertragsschließenden zum Zeitpunkt des Erbvertragsschlusses nicht in einer Ehe und eine solche war zunächst auch nicht geplant.
Sachverhalt:
Im vorliegenden Sachverhalt schlossen der Beteiligte zu 1 und die Erblasserin vier Jahre vor ihrer Eheschließung einen Erbvertrag. In diesem setzten sie sich mit wechselseitiger Bindungswirkung als Alleinerben ein. Erbe des Längstlebenden sollten der Beteiligte zu 2 – der einzige Sohn der Erblasserin – und die beiden Kinder des Beteiligten zu 1 sein. Weiterhin wurde dem Beteiligten zu 1 im Erbvertrag ein „Erwerbsrecht“ eingeräumt. Nach diesem sollte er ein Grundstück der Erblasserin zur Hälfte erwerben, wenn sich die Betroffenen trennten oder scheiden lassen würden. 21 Jahre nach der Eheschließung, ließen sich die Betroffenen scheiden. Im Zuge dieser Scheidung verhandelten die Erblasserin und der Beteiligte zu 1 über die Aufhebung des Erbvertrages. Eine entsprechende notarielle Urkunde wurde jedoch nie unterzeichnet.
Instanzengang:
Das Amtsgericht erteilte einen Erbschein auf den Beteiligten zu 1 als Alleinerben. Auch das Oberlandesgericht Zweibrücken (OLG) hat die Beschwerde des Beteiligten zu 2 zurückgewiesen. Nach der Ansicht des OLG richte sich die Erbfolge nach dem in Rede stehenden Erbvertrag. Die Eheschließung und spätere Scheidung der Ehegatten ändere hieran nichts.
BGH:
Auch der BGH geht von einem wirksamen Erbvertrag zwischen der Erblasserin und dem Beteiligten zu 1 aus und sieht den Beteiligten zu 1 als Alleinerben an. So ergäbe auch die Auslegung des Erbvertrages nicht, dass sich die Ehegatten zum Zeitpunkt der Schließung des Erbvertrages nicht als gegenseitige Alleinerben im Falle einer Eheschließung oder einer anschließenden Scheidung einsetzen wollten. Die Regelung des § 2077 Abs. 1 BGB beschreibe zwar, dass eine den Ehegatten begünstigende letztwillige Verfügung unwirksam sei, wenn die Ehe vor dem Tod des Erblassers aufgelöst würde, zugleich setze § 2077 Abs. 1 BGB jedoch auch voraus, dass sich die Vertragsparteien zum Zeitpunkt des Abschlusses des Erbvertrages überhaupt in einer Ehe oder einem Verlöbnis befanden. Die Ehegatten seien vorliegend allerdings zum Zeitpunkt des Abschlusses des Erbvertrages gerade nicht verheiratet und auch nicht verlobt gewesen.
„Die nach Auffassung des Beschwerdegerichts nachvollziehbare Einlassung des Beteiligten zu 1, es sei damals im Hinblick auf die beiderseitigen Scheidungen nicht an eine Eheschließung gedacht worden, wird zum einen dadurch bestätigt, dass diese erst viereinhalb Jahre nach Abschluss des Erbvertrages erfolgte, und zum anderen durch die Formulierung in dem notariellen Vertrag, wo lediglich eine “etwa nachfolgende Ehe“ erwähnt ist.“ (Rn. 16)
Ein ernstliches Eheversprechen sei nicht anzunehmen. So sei § 2077 Abs. 1 Satz 1 BGB hier auch nicht analog anwendbar. Es könne nicht der Ansicht gefolgt werden, dass § 2077 Abs. 1 BGB generell anwendbar sei, wenn später eine Eheschließung erfolge, da vorliegend die Verfügung nicht in Erwartung einer Eheschließung erfolgt sei. Ein Erblasser verknüpfe mit einer letztwilligen Zuwendung an einen nichtehelichen Lebensgefährten zwar die Erwartung des Fortbestehens einer partnerschaftlichen Verbindung. Nichteheliche Lebensgefährten unterließen andererseits jedwede rechtliche Bindung, die im Falle einer Trennung rechtliche Konsequenzen mit sich brächte, und wollten deswegen wohl auch gerade nicht den „automatischen“ Wegfall einer letztwilligen Verfügung. An dieser Bewertung ändere auch eine spätere Eheschließung – zumindest nicht unabhängig von einer Einzelfallbetrachtung – etwas.
„Bejahte man eine analoge Anwendung des § 2077 BGB stets, wenn ein nichtehelicher Lebensgefährte seinen Partner bedenkt und ihn später heiratet, würde aus der späteren Eheschließung in unzulässiger Weise nachträglich auf eine Willensrichtung des Erblassers im Zeitpunkt seiner letztwilligen Verfügung geschlossen […].“ (Rn. 21)
Fazit:
Der tatsächliche Wille des Erblassers ist stets entscheidend. Und somit gibt die einzelfallabhängige Auslegung des Testaments darüber Aufschluss, ob ein (analoger) Fall des § 2077 BGB gegeben ist. Festzuhalten bleibt, dass eine spätere Eheschließung und eine später folgende Scheidung derselben Ehe nicht in jedem Fall zu einem Wegfall der letztwilligen Verfügung führen.
Quellen:
BGH, Beschl. v. 22.05.2024 – IV ZB 26/23
Relevante Normen:
§ 2077 BGB – Unwirksamkeit letztwilliger Verfügungen bei Auflösung der Ehe
oder Verlobung
(1) Eine letztwillige Verfügung, durch die der Erblasser seinen Ehegatten bedacht hat, ist unwirksam, wenn die Ehe vor dem Tode des Erblassers aufgelöst worden ist. Der Auflösung der Ehe steht es gleich, wenn zur Zeit des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte. Das Gleiche gilt, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes berechtigt war, die Aufhebung der Ehe zu beantragen, und den Antrag gestellt hatte.
(2) Eine letztwillige Verfügung, durch die der Erblasser seinen Verlobten bedacht hat, ist unwirksam, wenn das Verlöbnis vor dem Tode des Erblassers aufgelöst worden ist.
(3) Die Verfügung ist nicht unwirksam, wenn anzunehmen ist, dass der Erblasser sie auch für einen solchen Fall getroffen haben würde.
Header & Beitragsbild: ©AdobeStock: Ingo Bartussek
