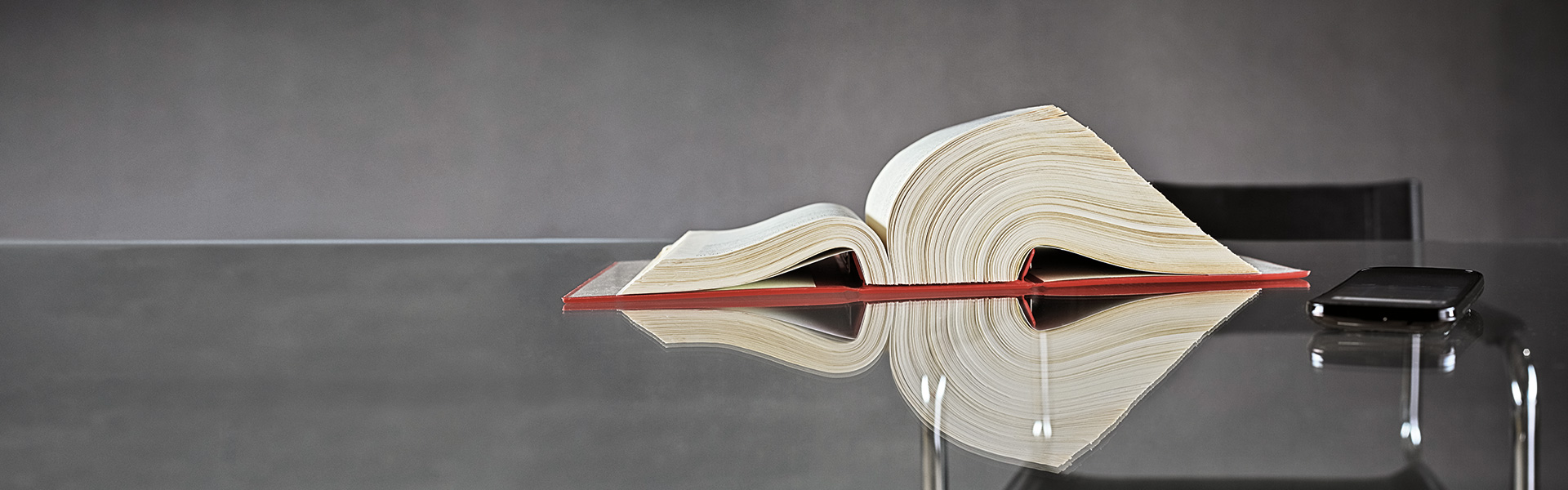
§ 1361b BGB - Anspruch auf Nutzungsentschädigung bei Überlassung der Ehewohnung

Einleitung:
Eine Scheidung bedeutet auch die räumliche Trennung der Ehegatten. Fraglich ist, wie mit einer gegebenenfalls vorhandenen Ehewohnung verfahren wird. In Bezug auf die Ehewohnung kann gem. § 1361b Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ein Ehegatte verlangen, dass ihm der andere Ehegatte die Ehewohnung oder einen Teil dieser zur alleinigen Nutzung überlässt. Abs. 3 des § 1361b BGB regelt die Benutzungsvergütung. So kann der auf den Besitz an der Ehewohnung verzichtende Ehegatte – zum Ausgleich des Verlustes des Besitzrechts – eine angemessene Nutzungsentschädigung verlangen. (vgl. MüKo/Weber-Monecke, BGB § 1361b, Rn. 17) Eben diese Nutzungsentschädigung beschäftigte im November 2024 den BGH.
Sachverhalt:
In dem, dem BGH vorliegenden, Fall waren die Ehegatten zu hälftigen Anteilen Miteigentümer eines Reihenhauses. Die Ehefrau verblieb nach dem Auszug des Ehemannes und des gemeinsamen Sohnes in der Ehewohnung. Der Ehemann beantragte daraufhin die Zahlung einer Nutzungsentschädigung.
Instanzengang:
Das Amtsgericht München (AG) sprach dem Ehemann eine monatliche Nutzungsentschädigung zu, die deutlich unter der beantragten Summe lag. Nach der Beschwerde beider Parteien, setzte das Oberlandesgericht München (OLG) eine etwas höhere Nutzungsentschädigung gegen die Ehegattin fest. Diese erhob dagegen – erneut mit dem Ziel einer vollständigen Antragsabweisung – Rechtsbeschwerde.
BGH:
Nach Ansicht des BGH gehe das Beschwerdegericht richtigerweise davon aus, dass dem, die Ehewohnung (freiwillig) verlassenden Ehegatten eine Nutzungsentschädigung gem. § 1361b Abs. 3 S. 2 BGB zustehe. Bei der Nutzungsentschädigung handele es sich um eine Kompensation des Verlustes des Besitzes an der Ehewohnung nach im Einzelfall zu bemessenden Billigkeitskriterien hinsichtlich des Grundes und der Höhe des Anspruchs. Weiterhin berücksichtige die Nutzungsentschädigung, dass ein Ehegatte nun die alleinige Nutzung aus der Ehewohnung ziehe, die zunächst beiden Ehegatten zustand. Über die Nutzungsvergütung im Einzelfall entscheide hierbei der Tatrichter. Die tatrichterliche Entscheidung sei daraufhin im Rechtsbeschwerdeverfahren nur begrenzt überprüfbar. Bezüglich der Billigkeit der Nutzungsentschädigung seien explizit die wirtschaftlichen und persönlichen Umstände der Ehegatten und ihrer gemeinsamen Kinder zu berücksichtigen. Auf Seiten des in der Ehewohnung verbleibenden Ehegatten ist der Vorteil des mietfreien Wohnens „und zwar entweder als bedarfsdeckendes und seine Bedürftigkeit minderndes Einkommen des Unterhaltsberechtigten oder als unterhaltsrelevantes und seine Leistungsfähigkeit erhöhendes Einkommen des Unterhaltspflichtigen“ (Rn. 11) zu berücksichtigen. Zu beachten bleibe hierbei:
„Ist der Wohnvorteil des in der Ehewohnung verbleibenden Ehegatten auf diese Weise im Rahmen einer Unterhaltsregelung – sei es durch außergerichtliche Verständigung, durch gerichtlichen Vergleich oder durch gerichtliche Entscheidung – familienrechtlich kompensiert worden, kommt daneben schon wegen des Verbots der Doppelverwertung ein Anspruch des weichenden Ehegatten auf Zahlung einer Nutzungsentschädigung nach § 1361b Abs. 3 Satz 2 BGB nicht mehr in Betracht […]. Insoweit besteht ein Vorrang der Unterhaltsregelung vor der Nutzungsvergütung, um zwischen den Ehegatten einen angemessenen Ausgleich für den Wohnvorteil zu bewirken.“ (Rn. 11)
Fraglich sei jedoch, was für den Fall gelte, in welchem eine solche Unterhaltsregelung fehle. Entscheidend blieben für die Bewertung der Billigkeit die unterhaltsrechtlichen Verhältnisse der Beteiligten.
„Gerade in Fällen, in denen der eigentlich einkommensschwächere Ehegatte im Hinblick auf den von ihm gezogenen Wohnvorteil auf die Geltendmachung von Trennungsunterhalt verzichtet hat, kann es nicht der Billigkeit entsprechen, ihn zur Zahlung einer Nutzungsentschädigung zu verpflichten, die ihm anschließend als Ergebnis eines gesonderten Trennungsunterhaltsverfahrens wieder zufließen müsste […].“ (Rn. 17)
In einem solchen Fall sei die Wohnungsüberlassung als Teil der Unterhaltsgewährung anzusehen. Der die Wohnung verlassende Ehegatte trage die Feststellungslast für die Billigkeit. Für die vorzunehmende Billigkeitsabwägung genüge zunächst eine grobe Prüfung. Der BGH riet dem Gericht „anzusinnen, die gebotenen Ermittlungen zu den Einkünften der Beteiligten und den berücksichtigungsfähigen Abzugspositionen durchzuführen und zumindest summarisch die damit zusammenhängenden unterhaltsrechtlichen Beurteilungen anzustellen“ (Rn. 22). Zu berücksichtigen bleibe, dass eine fehlende Leistungsfähigkeit eines Ehegatten nicht rechtfertige, dass dieser dauerhaft unentgeltlich in der Ehewohnung verbleibe. In dem vorliegenden Fall sei zudem die Ehewohnung für die Deckung des Wohnbedürfnisses der Ehefrau „ersichtlich zu groß“ (Rn. 24).
Fazit:
Grundsätzlich kann vom nutzungsberechtigten Ehegatten eine Vergütung für die Nutzung verlangt werden. Entscheidend ist jedoch – wie so häufig – der Einzelfall. Besonders in Fällen, in denen der Ehegatte dauerhaft in der Ehewohnung verbleibt, kann auch die fehlende Leistungsfähigkeit eine Unentgeltlichkeit nicht rechtfertigen. Auch die Wohnbelange der gemeinsamen Kinder können zu berücksichtigen sein und darüber entscheiden, wann eine Nutzungsentschädigung gerechtfertigt ist. Ebenso relevant ist die Beurteilung der Angemessenheit der Wohnbedürfnisse des nutzungsberechtigten Ehegatten.
Quelle: BGH, Beschl. v. 27.11.2024 – XII ZB 28/23
Relevante Norm:
§ 1361b BGB – Ehewohnung bei Getrenntleben
(1) Leben die Ehegatten voneinander getrennt oder will einer von ihnen getrennt leben, so kann ein Ehegatte verlangen, dass ihm der andere die Ehewohnung oder einen Teil zur alleinigen Benutzung überlässt, soweit dies auch unter Berücksichtigung der Belange des anderen Ehegatten notwendig ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. […]
(2) […]
(3) Wurde einem Ehegatten die Ehewohnung ganz oder zum Teil überlassen, so hat der andere alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Ausübung dieses Nutzungsrechts zu erschweren oder zu vereiteln. Er kann von dem nutzungsberechtigten Ehegatten eine Vergütung für die Nutzung verlangen, soweit dies der Billigkeit entspricht.
(4) […]
Header: ©AdobeStock: Ingo Bartussek, Beitragsbild: Andrii Yalanskyi
