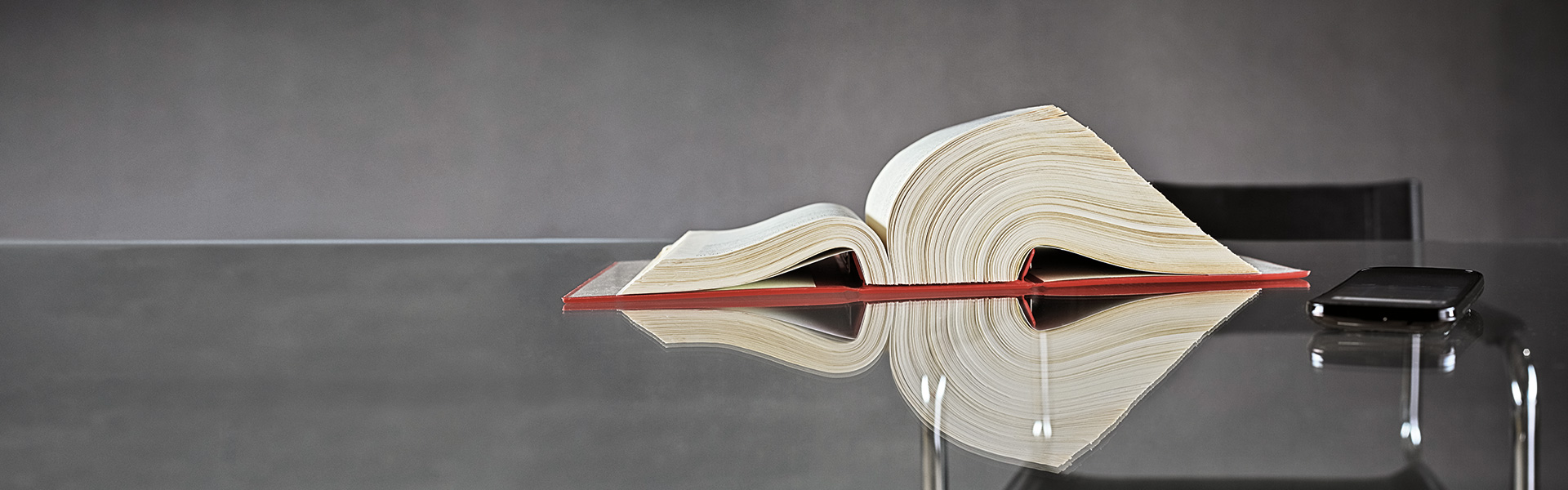
§ 199 BGB – Die Verjährung eines güterrechtlichen Anspruchs
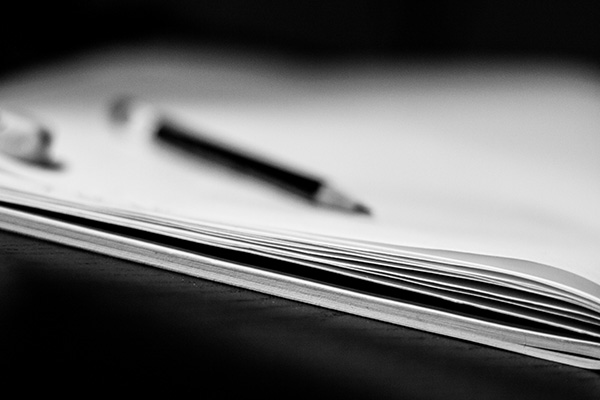
Einleitung:
Das Oberlandesgerichts Stuttgart (OLG) beschäftigte sich in einem Beschluss mit der Frage nach dem Beginn der Verjährung von güterrechtlichen Ansprüchen. Die Verjährung ist in der Juristerei ein scharfes Schwert. Nach dem Eintritt der Verjährung kann der Schuldner die Leistung verweigern – es besteht ein dauerhaftes Leistungsverweigerungsrecht.
Sachverhalt:
Im vorliegenden Fall streiten die Rechtsnachfolgerin der verstorbenen Ehegattin und die Rechtsnachfolgerin des verstorbenen Ehegatten um die güterrechtlichen Ansprüche des betroffenen, bereits verstorbenen Ehepaares. Die verstorbenen Ehegatten heirateten im Jahr 2001. Sie lebten danach im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft und trennten sich bis zum Jahr 2005 wieder.
Der Ehegatte stellte beim Amtsgericht Ulm im April 2017 einen Scheidungsantrag. Im August 2017 verstarb er. Erbe des Ehegatten war sein Bruder, der wiederum im Jahre 2023 verstarb. Der Bruder des Ehegatten beantragte noch zu seinen Lebzeiten einen Erbschein. Nach seinem Tod wurde die Antragsgegnerin die Rechtsnachfolgerin des verstorbenen Ehegatten.
Die Ehegattin richtete sich noch zu Lebzeiten gegen den beantragten Erbschein mit der Ansicht, dass ihr gesetzliches Erbrecht nicht durch den Scheidungsantrag ausgeschlossen sei. 2018 forderte sie den Bruder ihres bereits verstorbenen Ehegatten auf, Auskunft zu erteilen. 2019 verstarb die Ehegattin und ihre Schwester wurde ihre Rechtsnachfolgerin.
Das Familiengericht (Amtsgericht Ulm (AG)) wies die Ansprüche der Ehegattin zurück und hielt diese für bereits verjährt.
OLG Stuttgart:
Das OLG Stuttgart stimmte der Ansicht des AG Ulm zu und nahm ebenfalls eine Verjährung des Anspruchs auf Auskunftserteilung (§ 1379 BGB) und des Zugewinnausgleichsanspruchs (§§ 1371 Abs. 2, 1378 BGB) an. Der Anspruch auf Zugewinnausgleich nach §§ 1371 Abs. 2, 1378 BGB entstehe mit der Beendigung des Güterstandes und sei von da an auch vererblich.
Der Auskunftsanspruch nach § 1379 BGB entstehe ebenfalls mit der Beendigung des Güterstandes. Vorliegend beende der Tod des Ehegatten am 05.08.2017 den Güterstand. Zum Zeitpunkt des Todes des Ehegatten hätten die Voraussetzungen für die Scheidung bereits vorgelegen, sodass die Ehegattin nicht Erbin geworden sei. Der Auskunftserteilungs- und der Zugewinnausgleichsanspruch seien bei Eintritt des Todes der Ehegattin auf die Antragstellerin als Rechtsnachfolgerin übergegangen. Die beiden Ansprüche seien sodann mit dem Ablauf des Jahres 2022 verjährt. Für die Verjährung des güterrechtlichen Anspruchs würden die allgemeinen Verjährungsvorschriften – und somit die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren – gelten. Eine etwaige Sondervorschrift des § 1378 Abs. 4 BGB sei bereits zum 01.01.2010 aufgehoben worden.
„Die Verjährung des Anspruchs nach §§ 1371 Abs. 2, 1378 BGB beginnt nach § 199 Abs. 1 BGB mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger, hier die verstorbene Ehefrau, Kenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Abweichend von der früheren Regelung des § 1378 Abs. 4 BGB kommt es nicht mehr auf die Kenntnis der Beendigung des Güterstandes an.“ (Rn. 52)
Aufgrund seiner Unselbständigkeit beginne die Verjährung des Auskunftsanspruchs mit dem Beginn der Verjährung des Zahlungsanspruchs auf Zugewinnausgleich. Dieser sei mit der Beendigung des Güterstandes durch den Tod des Ehegatten entstanden.
„Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat die verstorbene Ehefrau bzw. die Antragstellerin erst, wenn sie um die zur Beendigung des Güterstandes führenden Tatsachen weiß und sie in ihrer rechtlichen Bedeutung erfasst hat […].“ (Rn. 57)
Für die Kenntnisnahme sei eine grob fahrlässige Unkenntnis ausreichend. Hierfür müsse der Ehegattin ein schwerer Obliegenheitsverstoß in ihren eigenen Angelegenheiten vorgeworfen werden können. Grundsätzlich müsse keine abschließende und richtige juristische Einordnung durch die Ehegattin für eine Kenntnisnahme erfolgen. Die Ehegattin habe die relevanten Umstände erfahren und es hätten keine Gründe bestanden, um ihre Kenntnis anzuzweifeln.
Auch sei es irrelevant, ob das Erbscheinsverfahren bereits abgeschlossen sei oder nicht. Der Wegfall der Sondervorschrift des § 1378 Abs. 4 BGB bezwecke „die Harmonisierung des Verjährungsrechts und die Anpassung der Verjährung familienrechtlicher Ansprüche an die Regelverjährung“ (Rn. 65). Eine Schlechterstellung der Ehegattin dürfe vor dem Hintergrund dieses Zweckes in Kauf genommen werden. Die Verjährung beginne auch dann, wenn noch nicht absehbar sei, ob und in welcher Höhe ein Anspruch auf Ausgleich bestehe.
„Es genügt, dass der Gläubiger auf Grund der ihm bekannten oder ohne grobe Fahrlässigkeit erkennbaren Tatsachen einen hinreichend aussichtsreichen, wenn auch nicht risikolosen Zugewinnausgleichsantrag oder zumindest einen entsprechenden Stufenantrag beim Familiengericht stellen kann […].“ (Rn. 68)
Nach der Entscheidung des Nachlassgerichts hätte die Ehegattin spätestens – zumal sie rechtlich beraten wurde – einen Stufenantrag gegen den bestellten Nachlasspfleger richten müssen. Da die Antragseinreichung erst knapp ein Jahr nach dem Eintritt der Verjährung erfolgt, wurde die Verjährungsfrist auch nicht gehemmt.
Hinweis:
Bei Betrachtung dieses Beschlusses ist auffällig, dass die entscheidenden Paragrafen – wie nicht selten – diejenigen aus dem Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches sind. Verjährungsbeginn und Verjährungsende lassen sich aus laienjuristischer Perspektive häufig schwer bestimmen. Eine fachanwaltliche Beratung – auch über die Spezifika des jeweiligen Rechtsgebietes – kann hier Abhilfe schaffen.
Quelle:
OLG Stuttgart, Beschl. v. 10.02.2025 – 11 UF 123/24
Relevante Norm:
§ 199 BGB – Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist […]
- Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
- der Anspruch entstanden ist und
- der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Header: ©AdobeStock: Ingo Bartussek
