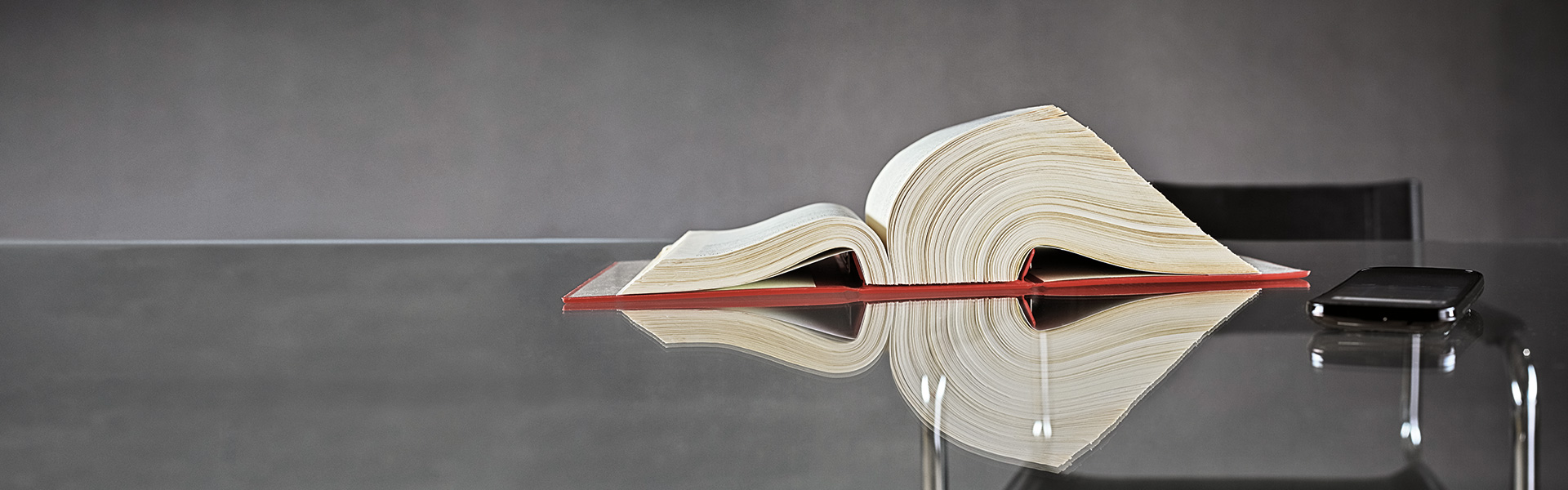
Der Elternunterhalt in der familienrechtlichen Praxis

Einleitung:
Begriffe wie Kindesunterhalt oder Trennungsunterhalt sind vielen geläufig. Was ist aber, wenn das Vermögen der Eltern nicht ausreicht, sich selbst zu unterhalten, etwa um die Pflegekosten zu decken?
Nach § 1601 BGB besteht gegenseitige Unterhaltspflicht für Verwandte in gerader Linie. Deshalb sind nicht nur Eltern zum Unterhalt für Kinder verpflichtet, bis diese selbst für sich sorgen können. Auch Kinder haben grundsätzlich eine Unterhaltspflicht gegenüber ihren Eltern.
Der gängige Ablauf ergibt sich demnach wie folgt: Die unterhaltsberechtigte Person beantragt zunächst Sozialleistungen (z.B. Hilfe zur Pflege oder Grundsicherung im Alter) beim Sozialamt. Wenn diese Leistungen vom Sozialamt gewährt werden, kann dieses unter nachstehenden Voraussetzungen bei den eigentlich verpflichteten Kindern Regress nehmen.
Wann müssen die Kinder zahlen?
Grundsätzlich wird durch die Zahlung des Sozialamts auf den Anspruch des Unterhaltsberechtigten (Eltern) gegen die Verpflichteten (Kinder), dessen Unterhaltsanspruch gemäß § 94 I S. 1 SGB XII auf den Sozialhilfeträger übergeleitet. Also kann das Sozialamt anschließend bei den Verpflichteten aus dem übergegangenen Unterhaltsanspruch Regress nehmen.
Um für eine Entlastung der Mittel- oder Geringverdiener zu sorgen, bestimmt die durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz im Jahr 2020 eingeführte Änderung von § 94 SGB XII, dass dieser Übergang der Ansprüche nicht stattfindet, wenn die Verpflichteten unter 100.000,00 € brutto jährlich verdienen.
Das Sozialamt kann also nur gutverdienende Kinder mit einem Jahresbruttoeinkommen ab 100.000,00 € in die Pflicht nehmen.
Im Jahresbruttoeinkommen enthalten ist jede Einnahmequelle vom Gehalt bis zu Zinseinnahmen. Dieser Betrag gilt pro Kopf. Falls diese Grenze erst als gemeinsamer Haushalt erreicht wird, entsteht noch keine Unterhaltspflicht.
Eltern zuerst, dann die eigene Familie?
Die eigene Familie muss sich aber nicht darum sorgen, drastische Abstriche bei ihrem Lebensstandard zu machen oder gar ihre eigene Altersvorsorge hintenanstellen zu müssen, um die Unterhaltsverpflichtungen zu erfüllen. Den Kindern muss mindestens genug bleiben, um vorrangig Unterhaltsverpflichtungen gegenüber den eigenen Kindern oder Partnern erfüllen zu können. Außerdem soll der gewohnte Lebensstil weitgehend erhalten bleiben.
Auch muss das selbst genutzte Wohneigentum nicht zur Anspruchserfüllung eingesetzt werden, lediglich die der angemessenen Miete entsprechenden Ersparnisse werden bei der Einkommensberechnung berücksichtigt.
Wie berechnet sich der Unterhalt?
Zunächst ist der Bedarf des Unterhaltsberechtigten zu ermitteln. Dieser stellt die Obergrenze des Unterhaltsanspruchs dar. Der Bedarf des Elternteils an Unterhalt bestimmt sich nach den jeweiligen Lebensumständen (§ 1610 Absatz 1 BGB). Lebt er in einem Pflegeheim,
beträgt der Bedarf daher die Kosten dieses Pflegeheims (also Unterkunft und Pflege) sowie die Verpflegung. Auf diesen Bedarf sind Leistungen der Pflegeversicherung und eigenes Einkommen, insb. die Rente anzurechnen. Können damit nicht alle Kosten gedeckt werden, kommt ein Unterhaltsanspruch gegen die Kinder in Betracht.
In welcher Höhe die Kinder im Einzelnen verpflichtet sind, berechnet sich wie folgt:
Ausgangspunkt der Berechnung ist das bereinigte Nettoeinkommen der Verpflichteten, basierend auf dem Durchschnitt der vergangenen 12 Monate; bei Selbstständigen 36 Monate.
Einen konkreten Selbstbehalt sieht das Gesetz nicht vor, jedoch hat der BGH mit Urteil vom 23.10.2024 für Singles 2.650,00 € und Paare 4.000,00 € angesetzt.
Einer für alle, alle für einen, oder?
Wenn von mehreren Kindern auch mehrere über der Einkommensschwelle von 100.000,00 € brutto liegen, sind beide anteilig verpflichtet. Dabei sind sie jedoch gemäß § 1606 III S. 1 BGB nicht Gesamtschuldner, sondern jeweils für einen eigenen, nach dem Einkommen bestimmten Anteil, verantwortlich. Der auf den Abkömmling mit einem Jahresbrutto unter 100.000,00 € entfallende Anteil kann jedoch nicht den Geschwistern auferlegt werden. Dieser verbleibt also beim Sozialamt.
Resümee und Ausblick
Das Gesetz bietet eine Grundlage dafür, einen angemessenen Ausgleich zwischen einer solidarischen Einstandspflicht für die Eltern und der Wahrung des eigenen Lebensstandards zu finden. Es hilft, finanziell schwächere Angehörige, die vor der Novellierung die durch das Sozialamt gezahlten Beträge hätten erstatten müssen, zu entlasten. Dennoch liefern Interpretationsspielräume, wie der unbestimmte Selbstbehalt, viel Konfliktpotenzial und Stoff für gerichtliche Verfahren. Des Weiteren führt dieser Ausschluss der Überleitung der Ansprüche zu einer stärkeren Belastung des Sozialstaats und zu sozialstaatlich ungerecht anmutenden Ergebnissen, nämlich dann, wenn in Einzelfällen, bei denen das Einkommen knapp unter der gesetzlichen Grenze von 100.000,00 € liegt, kein Regress erfolgt, obwohl die unterhaltspflichtige Person grundsätzlich leistungsfähig wäre.
Relevante Normen und Urteile:
- BGH-Urteil vom 23. Oktober 2024 (AZ. XII ZB 6/24)
- §§ 1601 ff. BGB
- § 94 SGB XII
