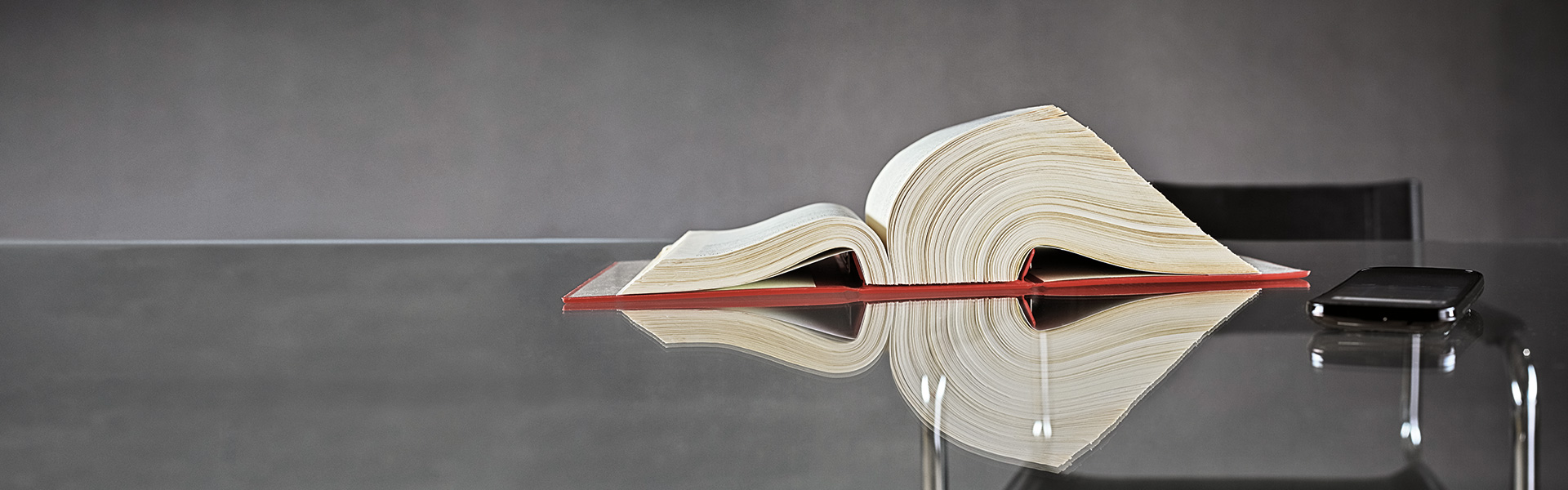
Umfang des Pflichtteilsverzichts gem. § 2346 BGB
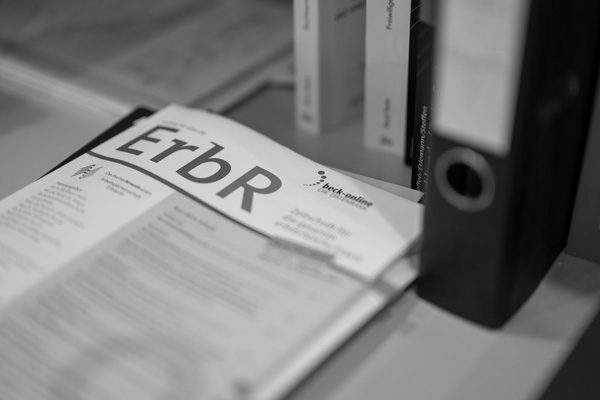
Vermeidung von Pflichtteilsansprüchen von Abkömmlingen zur Absicherung des überlebenden Ehegatten – ein häufige Frage aus der Praxis.
Grundsätzlich hat jeder Abkömmling und auch der Ehegatte einen gesetzlichen Anspruch auf den Sogenannten Pflichtteil – einer Mindestteilhabe am Nachlass einer verstorbenen Person. Abgesehen von seltenen Ausnahmen, bedarf es hierzu einer Vereinbarung mit der pflichtteilsberechtigten Person. Gem. § 2346 BGB kann mittels notarieller Vereinbarung ein solcher Pflichtteilsverzicht zwischen dem Abkömmling und der/m potenziellen Erblasser*in vereinbart werden.
Die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang häufig stellen sind beispielsweise: Ist dieser Pflichtteilsverzicht endgültig und allumfassend, kann er an Bedingungen geknüpft werden, wie z. B. den Erhalt eines Gegenwertes (z. B. einer Abfindungszahlung oder der Übertragung eines Vermögensgegenstandes zu Lebzeiten), kann er unter eine aufschiebende oder auflösende Bedingung gestellt werden?
Der häufigste Anwendungsfall eines Pflichtteilsverzichts ist die gegenseitige Absicherung der überlebenden Ehegatten vor den Pflichtteilsansprüchen der Kinder. Dies wird häufig im Rahmen von sogenannten Berliner Testamenten vereinbart. Darin setzen sich Ehegatten zunächst gegenseitig als Alleinerben ein, die Abkömmlinge folgen dann als Schlusserben. Durch einen Pflichtteilsverzicht der Abkömmlinge kann sichergestellt werden, dass ausschließlich der überlebende Ehegatte über das zum Nachlass gehörende Vermögen verfügen kann und darf.
Um das Risiko für die verzichtenden Abkömmlinge zu verringern, keinerlei Teilhabe am Nachlass zu erlangen (z. B. durch eine Enterbung auch im Schlusserbfall), besteht rechtlich die Möglichkeit, den Pflichtteilsverzicht für den ersten Erbfall unter eine sogenannte auflösende Bedingung zu stellen. Ihrnach entfällt der Verzicht, wenn der Überlebende berechtigt ist, nach dem Tode des Erstversterbenden neu zu testieren und von diesem Recht gebraucht macht. Oder wenn durch Hinzutreten weiterer neuer Pflichtteilsberechtigte (z. B. durch Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten) eine Beeinträchtigung herbei geführt wird, die zum Zeitpunkt der Erklärung des Pflichtteilsverzichts noch nicht gegeben war.
Problematisch wird es, wenn in der entsprechenden notariellen Vereinbarung hierzu keine Ausführungen gemacht werden. Wenn also vom Wortlaut her ein unbedingter Pflichtteilsverzicht erklärt worden ist und dann später die vorgenannten Bedingungen und Änderungen eintreten. Hier stellt sich häufig die Frage, ob durch Auslegung des Pflichtteilsverzichtsvertrages eine auflösende Bedingung nachgewiesen werden kann, die zwar nicht ausdrücklich vereinbart ist, aber möglicherweise nach dem Willen der Beteiligten vereinbart worden sein könnte.
In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine Bedingung oder Befristung eines Pflichtteilsverzichtes nicht ausdrücklich formuliert werden muss, sondern tatsächlich auch stillschweigend vereinbart worden sein kann. Man muss dann in einer Gesamtwürdigung der notariellen Verträge sowie der Verfügungen von Todes wegen prüfen, ob eine solche Bedingung möglicherweise ohne explizierte Erwähnung vereinbart worden sein könnte.
Um solche Schwierigkeiten zu vermeiden wäre es wichtig, im Falle eines Pflichtteilsverzichts eindeutig zu regeln, für welche Fälle dieser Verzicht gelten soll und ob es Konstellationen gibt, die es dem Verzichtenden ermöglichen, von diesem Verzicht Abstand zu nehmen.
Header: ©AdobeStock: Ingo Bartussek
